Engagement

Juni 2021: Entwicklung von Erhaltungsstrategien für den Leuchtturm Roter Sand
Januar 2018: ASBau-Referenzrahmen für Studiengänge des Bauingenieurwesens beinhaltet Bautechnikgeschichte
November 2016: DFG-Rundgespräch zu Entwicklungsperspektiven für die Bautechnikgeschichte
→ Positionspapier (pdf-Dokument)
Auf Vorschlag des Lehrstuhls Bautechnikgeschichte und Tragwerkserhaltung der BTU Cottbus-Senftenberg (Prof. Dr.-Ing. Werner Lorenz) und des Instituts für Bauwerkserhaltung und Tragwerk der Technischen Universität Braunschweig (Dr.-Ing. Christina Krafczyk) hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG für Anfang November die ‚Scientific Community’ des Fachgebiets zu einem Rundgespräch „Geschichte der Bautechnik – Neue Verbundperspektiven in der Forschung und deren Integration in Lehrkonzepte“ eingeladen. Ausgerichtet wurde es von den beiden Vorschlagenden am 4. und 5. November 2016 an der BTU Cottbus-Senftenberg. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch Mittel der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte.
Die DFG finanziert ‚Rundgespräche’ mit dem Ziel, in offenen, aber gut vorbereiteten Diskussionen der renommierten Vertreter eines Faches Perspektiven für mögliche DFG-Verbundprojekte (wie z.B. Forschergruppen oder Schwerpunktprogramme) auszuloten. Bereits 2003 und 2009 hatte der Lehrstuhl von Werner Lorenz in Cottbus Rundgespräche ausgerichtet; das erste war vornehmlich einer Standortbestimmung im nationalen Kontext, das zweite dann der Internationalisierung der Forschung gewidmet gewesen. Zwischenzeitlich hat sich die vergleichsweise junge Disziplin national wie international deutlich konsolidiert. Vor diesem Hintergrund thematisierte das nun dritte Rundgespräch zwei aktuelle Fragen:
- Welche übergeordneten, perspektivisch interdisziplinären Themen und Fragestellungen zeichnen sich in der gegenwärtigen Forschungslandschaft ab, die den Nukleus möglicher neuer Verbundprojekte bilden könnten?
- Welche Relevanz und welches Potenzial kommen der Bautechnikgeschichte heute im Wissenschaftskanon von Bauingenieurwesen und Architektur zu, und welche Konzepte lassen sich entwickeln, um Bautechnikgeschichte als Fachgebiet der Bauwissenschaften angemessen in die Lehre zu integrieren?
Eine der Stärken von Bautechnikgeschichte liegt gerade in den Synergieeffekten der Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen und Berufsfelder. So kamen die insgesamt 35 deutschen wie internationalen Teilnehmer auch nicht nur aus Architektur und Bauingenieurwesen, sondern auch aus Archäologie, Denkmalpflege und Wissenschafts- und Technikgeschichte. Neben Universitäten und Fachhochschulen waren Gäste der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte sowie das Deutsche Archäologische Institut und das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin vertreten.
Im Ergebnis der gleichermaßen kontroversen wie konstruktiven Diskussionen wurden drei Forschungsfelder benannt, die in den kommenden Monaten von Arbeitsgruppen näher auf ihr Verbundpotenzial hin konkretisiert werden sollen: „Tragwerke und Techniken der Antike“, „Konstruktion, Architektur und Instandsetzung 1918-1968“ sowie das diachrone Thema „Reparatur“ als selbstverständlicher, aber bislang kaum beachteter Teil des Bauens.
Sechs Präsentationen zu verschiedenen Lehrmodellen wie auch Vorarbeiten der Arbeitsgruppe „Lehre“ der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte zeigten auf, dass Bautechnikgeschichte, auch wenn sie nur an der ETH Zürich, der BTU Cottbus und der FH Potsdam explizit als Lehrstuhl oder Professur vertreten ist, doch bereits an vielen Hochschulen im Rahmen von Vorlesungen, Seminaren oder Projektübungen der Baugeschichte, Tragwerkslehre oder Bauwerkserhaltung gelehrt wird. Gerade angesichts des immer wichtigeren Lehr-, Forschungs- und Berufsfelder im Bestand kommt ihr als Grundlagenfach wachsende Bedeutung zu. Betont wurden auch die Potenziale in der Lehre als Korrektiv für die oft beklagte Trennung von Bauingenieurwesen und Architektur sowie die kritische Reflexion heutiger Methoden im Bauwesen.
Die offenen Gespräche der beiden Tage, die auf hohem fachlichen Niveau weniger das disziplinär Trennende als vielmehr das Vermittelnde in den Vordergrund stellten, machten deutlich, wie viel Bautechnikgeschichte gerade durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gewinnen kann. Die nächsten Monate werden zeigen, inwieweit aus den anregenden Diskussionen ein oder mehrere konkrete Verbundanträge generiert werden können. (Werner Lorenz)
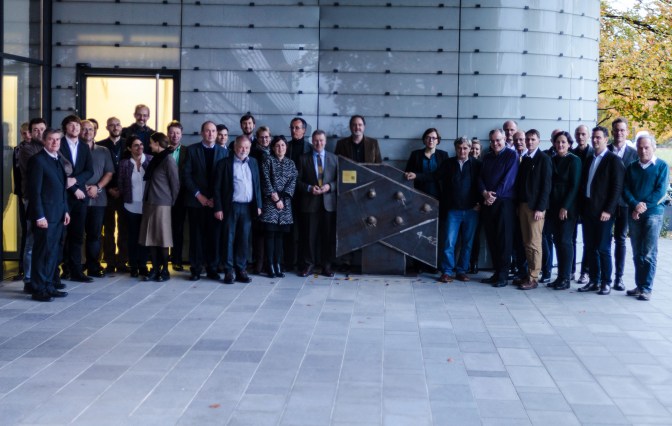 Gruppenfoto mit Pathenon-Knoten (Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
Gruppenfoto mit Pathenon-Knoten (Foto: BTU Cottbus-Senftenberg)
——————————————
Kant-Garagen-Palast in Berlin-Charlottenburg
Update November 2016:
2013 hatte sich die Gesellschaft für Bautechnikgeschichte einer Initiative für den Erhalt der Kant-Garage angeschlossen und in der Folge immer wieder auch in die Diskussion eingebracht. Durch einen Eignerwechsel ist der mögliche Abriss nun endgültig vom Tisch: Geplant ist eine Umnutzung des Gebäudes durch Galerien, Gastronomie, Büros und Ausstellungen zur Zukunft des Automobils.
→ Tagesspiegel (27. Oktober 2016)
→ rbb Abendschau (1. November 2016)
September 2013: Kant-Garagen-Palast in Berlin-Charlottenburg – Appell für den Erhalt
In Berlin droht der Abriß des Charlottenburger Kant-Garagen-Palastes. Das von 1929 bis 1930 errichtete Verkehrsbauwerk ist ein Schlüsselbau der damals neuen Bauaufgabe Hochgarage – und mit doppelgängiger Wendelrampe sowie gläserner Vorhangfassade nahezu einzigartig in Europa. Die Gesellschaft für Bautechnikgeschichte hat sich einer Initiative angeschlossen, die sich für den Erhalt der Kant-Garage einsetzt.
→ Lesen Sie den Appell für den Erhalt der Kant-Garagen. (pdf-Dokument)
——————————————
Eisenbahnviadukt Chemnitz
Update April 2016:
Immer mehr Personen, Politiker und Institutionen sprechen sich für den Erhalt des Viadukts aus. In der Ausgabe 16/2016 berichtet nun auch Spiegel-Journalist Christian Wüst über die laufende Diskussion zur Zukunft des Chemnitzer Viadukt – zu Wort kommt u.a. auch unser Vorsitzender Werner Lorenz. Fazit des Artikels: Oft wird leichtfertig für einen Abriss technischer Bauten plädieren.
→ Spröde Schönheit. Die Bahn will ein Brückendenkmal in Chemnitz abreißen. Dabei ist das alte Bauwerk gar nicht schrottreif – Der Spiegel 16/2016
(aus urheberrechlichen Gründen kann der vollständige Artikel leider nicht verlinkt werden)
Update November 2015:
Der Kampf um den Erhalt des Chemnitztalviadukts muss nun doch in eine neue Runde gehen: Die Bahn hat den Abriss des Bauwerks beschlossen und am vergangenen Dienstag hierzu die Chemnitzer Öffentlichkeit informiert.
→ Freie Presse Chemnitz (15. November 2015)
Ein engagiertes Plädoyer für den Erhalt dieses Wahrzeichens historischer Ingenieurbaukunst ist der Film „Viadukt Chemnitz“ des Chemnitzer Filmteams ARSIDA:
Juni 2015: Expertenrunde zur Zukunft des Eisenbahnviadukts Chemnitz überzeugt Chemnitzer Städträte
Aufgrund laufender Neubauplanungen ist schon seit Längerem der Erhalt des Eisenbahnviadukts Chemnitz, eines der bedeutendsten historischen technischen Bauwerke Sachsens, gefährdet. Bereits im Rahmen unseres Workshops in Dresden im November 2014 hatte die Gesellschaft für Bautechnikgeschichte deshalb das Viadukt besucht [→ Link zum Artikel Freie Presse Chemnitz (3. November 2014)] und in der Folge auch die Durchführung einer Expertenrunde mitinitieren können, an der unser Vorsitzender Werner Lorenz teilnahm.
Als Ergebnis der Expertenrunde im Juni 2015 sprachen sich Stadträte aller Chemnitzer Fraktionen für den Erhalt der Brücke, die Teil eines Denkmalenseblems ist, aus. Gleichwohl will die Bahn in Kürze ein offizielles Planungsverfahren anstreben.
Presseberichte über die Expertenrunde:
→ Chemnitzer MorgenPost (25. Juni 2015)
→ Freie Presse Chemnitz (24. Juni 2015)
→ Freie Presse Chemnitz (25. Juni 2015)
——————————————
März 2014: Schuchows Sendeturm in Moskau – Einer Ikone der Bautechnikgeschichte droht der Abriss!
Die Gesellschaft für Bautechnikgeschichte hat gemeinsam mit den Schwestergesellschaften in Europa und den USA eine Petition auf den Weg gebracht, die den Entscheidungsträgern in Moskau deutlich machen soll, was für einen enorm hohen Stellenwert der nach Plänen von Vladimir G. Schuchow 1919 bis 1922 errichtete Turm für die Bautechnikgeschichte weltweit hat.
Update Juli 2014: Schabolowka gerettet!?!
Nachdem die russische Präsidentenadministration noch vor einem Monat die Demontagepläne für den Schabolowka-Radioturm von Wladimir Schuchow bestätigt hatte, scheint sich das Blatt für den Turm nun doch zu wenden: Laut Archnadzor, einem Verein, der sich für Denkmale einsetzt, hat das Moskauer Stadtparlament bereits am 16. Juni in einer nichtöffentlichen Sitzung entschieden, die Demontage zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuführen. Als Quelle wird von Archnadzor der Staatssekretär Alexei Volin genannt. Diskutiert wird nun angeblich die Durchführung eines Wettbewerbes bei dem Szenarien für die Zukunft des Turms entwickelt werden sollen. (Ekaterina Nozhova, Christoph Rauhut)
→ Lesen Sie den offenen Brief der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte. (pdf-Dokument)
→ Pressemitteilung der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte vom 2. April 2014. (pdf-Dokument)